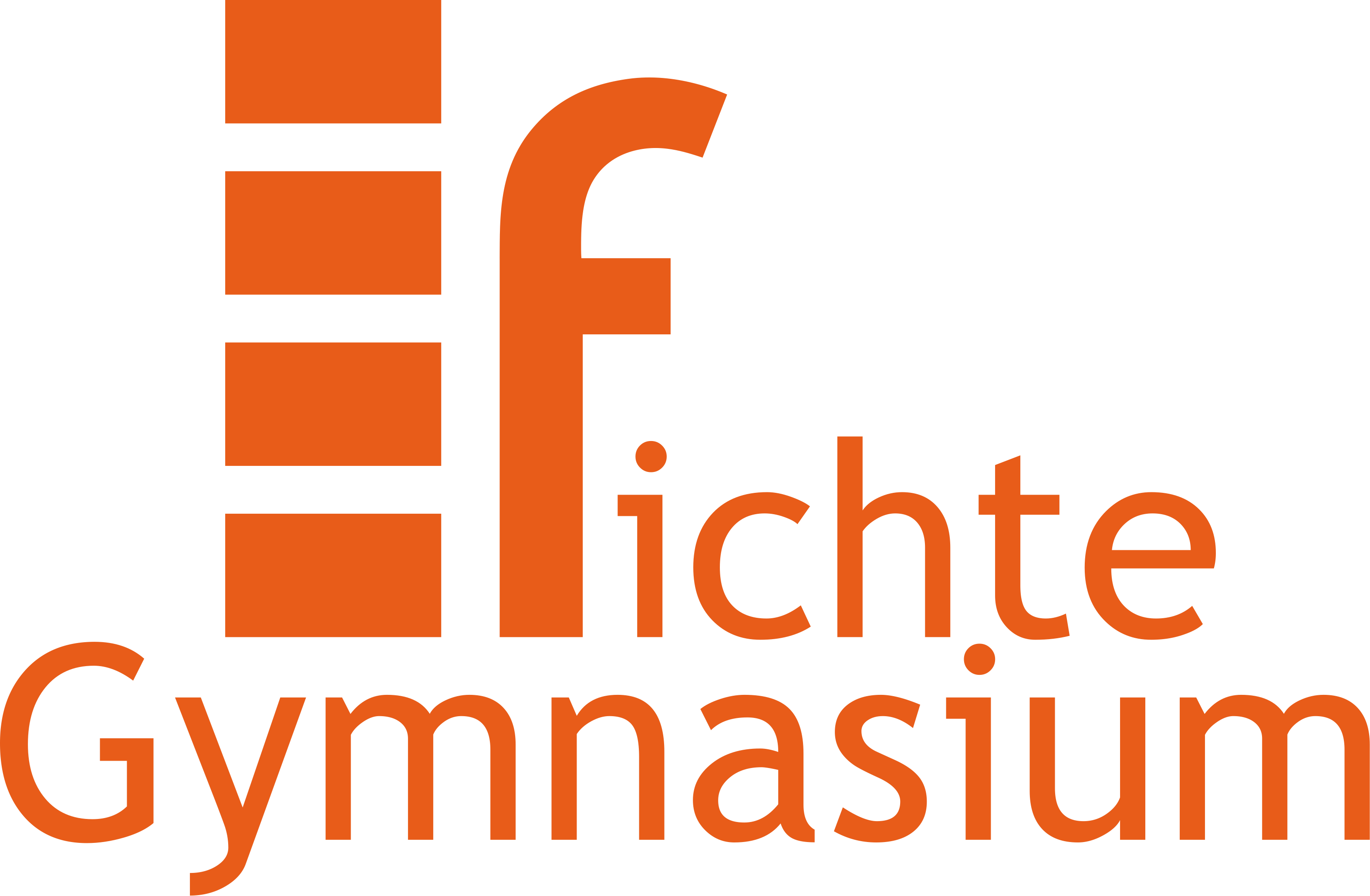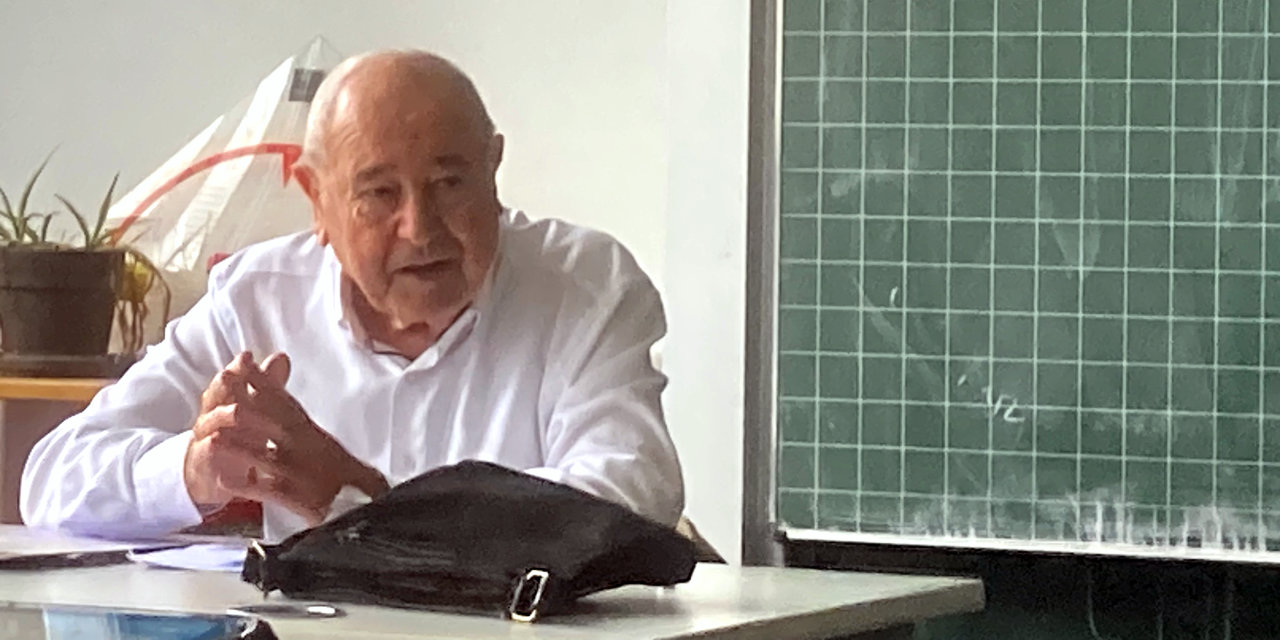Am Montag, den 02. Juni, erhielt der bilinguale Geschichtsgrundkurs der K1 den besonderen Besuch eines ehemaligen Landtagsabgeordneten und ehrenamtlichen Zeitzeugen, Günter Fischer. Im Rahmen des Kapitels über den Nationalsozialismus und die Shoah erhielt der Kurs so einen bereichernden Einblick in die persönliche Geschichte einer halbjüdischen Familie während der NS-Diktatur und lernte dabei auch die Lokalgeschichte Karlsruhes, insbesondere Hagsfelds, näher kennen. Günter Fischers Besuch war für uns so auf vielfältige Art und Weise bereichernd.
Günter Fischer wurde 1941 als Sohn einer jüdischen Mutter und eines protestantischen Vaters in Hagsfeld geboren. Nach seinem Schulabschluss wurde er als Handwerksmeister in den Jahren 1966 bis 1986 selbstständig. Beruflich engagierte er sich ebenso als Landtagsabgeordneter in der Landespolitik von Baden-Württemberg. Daneben war er als Mitglied in mehreren Ausschüssen und Verwaltungsräten tätig. Neben seiner politischen Funktionen und Posten kumuliert Fischer viele Vereinsmitgliedschaften und Ehrenmitgliedschaften.
Günter Fischer begann sich näher mit seiner Familiengeschichte zu beschäftigen, als er im Rahmen seiner politischen Arbeit in der Karlsruher SPD zur Ludwig-Marum-Preisvergabe im Jahr 2019 mit der damaligen Preisträgerin und Historikerin Nora Krug als Zeitzeuge ein Gespräch über seine Familiengeschichte führen sollte.
Seine Vorfahren mütterlicherseits, die Traubs, waren sogenannte „Schutzjuden“, die Bürgerrechte hatten und meistens wichtige Handwerkerberufe ausübten, aber auch als Vorsänger und Schullehrer in der jüdischen Gemeinde in Grötzingen gut in der Gesellschaft integriert waren, so wie Leopold Traub. Sein Bruder Ludwig Lazarus war Kaufmann und hatte, mit Thekla Groß verheiratet, 3 Töchter, Mina, Jenny und Regina “Recha”. Zusammen mit anderen Grötzinger Juden wurden sie im Jahr 1940 nach Guers (Südfrankreich) im Arbeitslager deportiert, der später als „Vorhölle von Auschwitz“ in die Geschichtsbücher eingehen würde. Dort sterben Leopold und Ludwig. Seine Töchter Mina und Jenny werden später nach Auschwitz deportiert und dort umgebracht.
Ludwig Lazarus’ Tochter Regina „Recha“ wird jedoch aufgrund ihrer “Mischehe” mit dem Hagsfelder Protestanten Erwin Fischer zunächst verschont. Gemeinsam bekommen sie 6 Kinder, darunter Günter Fischer. Die Kinder werden protestantisch getauft und großgezogen, aber die jüdischen Feiertage werden ebenso respektiert. Während des Nationalsozialismus (1933-1945) und der zunehmenden Verfolgung der Juden werden Regina Fischer und ihre Kinder fürs Erste aufgrund ihrer „Mischehe“ mit Erwin Fischer und ihrer sozialen Integration verschont. Während des zweiten Weltkriegs (1939-1945) wird der Vater als Soldat in die Wehrmacht eingezogen und stirbt dort vermutlich als Gefangener Soldat während der Belagerung von Stalingrad im Jahr 1942. Regina Fischer zieht nach der Bombennacht vom 24. zum 25. April in Hagsfeld, in der das Wohnhaus der Fischers zerstört wird, mit ihren Kindern nach Hagsfeld zu Bekannten, die ihr eine Unterkunft anbieten.
Während ihre zwei Töchter und zwei Söhne mithilfe von Unterstützern aus dem sozialen Umfeld in Sicherheit gebracht werden, werden ihre beiden ältesten Söhne Herbert und Emil 1944 „aus rassischen Gründen“ in Arbeitslager in Rouen deportiert, von wo sie aus später entkommen und zurückkehren können. Als Emil an einer Lungenentzündung erkrankt, folgt ihm die Familie nach Flehingen und zieht in ein Haus von Bekannten ein.
Regina Fischer wird im Februar 1945 von der Gestapo gefunden und aufgrund eines amtlichen Befehls, alle jüdischen Ehepartner aus sogenannten „Mischehen“ zum Arbeitseinsatz nach Theresienstadt zu schicken, deportiert. Heute wird Theresienstadt mit grausamen Menschenversuchen und Experimenten sowie tödlichen Seuchen und unmenschlichen Lebensbedingungen in Verbindung gebracht.
Die Kinder, zwischen 4 und 14 Jahre alt, müssen nun alleine zu Fuß zu ihren Großeltern (väterlicherseits) nach Büchig gehen. Regina erkrankt im KZ Theresienstadt an Typhus.
Sie kann jedoch nach der Befreiung des KZs durch die rote Armee im Mai 1945 zu ihren Schwiegereltern und Kindern nach Büchig und schließlich zurück nach Hagsfeld zurückkehren.
Ihre Mutter, Thekla Traub, kehrt ebenfalls Jahre später aus dem Arbeitslager und einem Aufenthalt im Altersheim in Frankreich nach Hagsfeld zurück. Bis zu ihrem Tod im Jahr 1950 redet sie nicht mehr, wie Günter Fischer anmerkt. Regina Fischer erlebt während dieser Zeit, wie sich viele Mitbewohner bei ihr um einen „Persilschein“ bemühen, um ihre Verzeihung für mögliche Taten während der NS-Zeit zu suchen und sich so wieder „reinzuwaschen“. Im Jahre 1955 stirbt Regina an den Folgen ihrer Typhuserkrankung und wird im jüdischen Friedhof in Karlsruhe begraben.